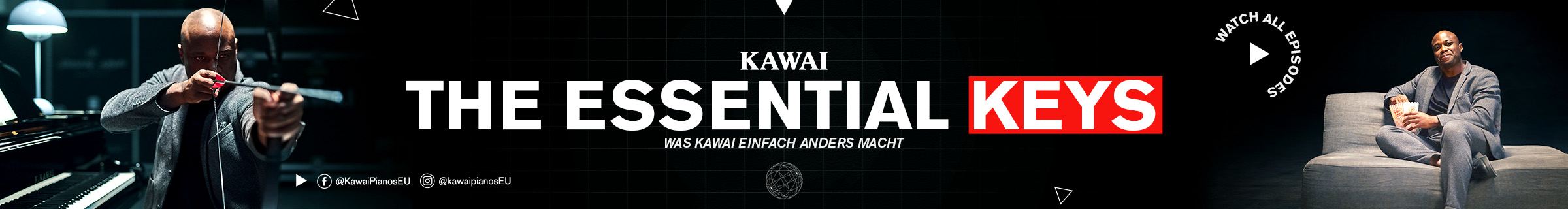Notenlesen hab ich als Beifang aus Chorsingen und Musik- und Klavierunterricht gelernt.
Ich habe immer versucht, Noten zu lesen, weil ich sie als Eingabematerial für den Computer benötigte. Doch was mir bis heute unmöglich erscheint, ist, diese Noten in dem erforderlichen Tempo auf einem Instrument so zu spielen, dass dabei wirklich Musik entsteht.
Ob ich den Gehalt eines Werks erfasste, durfte mir in der Künstlerrolle vollkommen egal sein.
Ich bin der Meinung, dass Künstler*innen in der Lage sein sollten, die künstlerische Idee hinter dem, was aufgeführt wird, wirklich zu verstehen. Dieses Verständnis halte ich für unerlässlich, um eine Partitur angemessen interpretieren zu können.
Ich habe mich bereits mehrfach mit diesem Thema beschäftigt – einerseits im Kontext des Übens, insbesondere dann, wenn die Proben in Anwesenheit des Komponisten stattfinden; andererseits, wenn es darum geht, eine Partitur lebendiger umzusetzen, als es mit einer statischen MIDI-Datei möglich wäre.
Ob ich "Künstler" unter Künstlern anerkannt war ist eine andere Frage ... aber wichtig?
Diese Frage beschäftigt mich schon seit einiger Zeit: Wenn ich bestimmten Personen erzähle, dass ich Komponist bin, reagieren manche so, als hätte ich den Verstand verloren – manche schreiben sogar der Krankenkasse, ich hätte eine psychische Störung. Deshalb sage ich lieber, dass ich mich mit der Gestaltung von Musik am Computer beschäftige. Das klingt für viele verständlicher und wird ernster genommen.
Die Komponisten der von mir vertonten Werke waren alle tot, konnten mir nicht den Knüppel übern Schädel ziehen,
Nun, sie könnten sich leider nicht mehr darüber beschweren, was du aus ihren Werken gemacht hast – das soll nicht ganz ernst gemeint sein und nicht als Kritik verstanden werden. Trotzdem gibt es so etwas wie eine informierte historische Aufführungspraxis, die man beachten sollte.
nd über "Banause!"-Rufe Schultern zu zucken fiel mir relativ leicht.
Ich habe nicht so sehr das Problem, als Banaus zu gelten. Da ich sehr avantgardistische Musik mache, glaube ich ohnehin nicht, komplett verstanden zu werden. Vielmehr befürchte ich, dass man mir eher einen ICD-10-Diagnoseschlüssel zuordnet, als wirklich hinzuhören
Wofür ich kein Händchen haben dürfte, ist musikalischer Ausdruck, weil das ohnehin nur in Echtzeit geht, nach Jahrzehnten disziplinierter Übung (oder Talent?
Das kann und will ich nicht entscheiden – zum einen habe ich von dir bisher noch zu wenig gehört. Vielleicht könntest du mir etwas von deiner Musik zeigen, wenn du möchtest. Zum anderen denke ich, dass es eine reine Geschmacksfrage ist, über die man bekanntlich endlos diskutieren kann. Was mir jedoch etwas seltsam vorkommt, ist, wie du diese Arbeit angehst, ohne die Idee des Komponisten wirklich zu verstehen.
In Notation lassen sich Gestaltungshinweise festhalten
Ich möchte einen Gedanken anbringen: Ich glaube, dass Abkürzungs- und Verzierungszeichen dazu dienen, eine Partitur leichter lesbar und verständlicher zu machen. Würde man alles ausschreiben, wäre das viel komplizierter und unübersichtlicher. Für mich ist das vergleichbar mit der Strukturierung eines Computerprogramms in Funktionen, die den Code klarer und einfacher handhabbar machen.
und von da – will man den maschinellen Weg über das statische Audiorendering gehen – erledigt Mathematik und Programmierung den Rest.
Wie bereits erwähnt, halte ich es für möglich, mithilfe dieses Ansatzes eine Note auch ohne menschliche Hilfe oder spezielle KI von der Partitur in eine MIDI-Datei umzuwandeln – wie ich weiter oben bereits erläutert habe. Allerdings benötigen diese Prozesse eine große Menge an Daten, um daraus zu lernen, oder sie müssen auf klar definierten Regeln basieren.
Der jedes Mal gleich ist, daher ist es technisch gesehen unnötig diese Renderings im Audioformat weiterzugeben, die Notation genügt eigentlich.
Ich würde das Rezept nicht dem Kuchen vorziehen – besonders nicht, wenn das Rezept immer zum gleichen Kuchen führt. In so einem Fall bevorzuge ich den fertigen, schmackhaften Kuchen. Anders gesagt: Ich würde die Audiodatei der MIDI-Datei vorziehen.
Ja, der elektronischen Musik stehe ich ambivalent gegenüber.
Für mich ist elektronische Musik die einzig mögliche Form von Musik, weil ich keine Instrumente spielen kann und daher auf den Computer angewiesen bin. Außerdem klingt für mich alles, was aus dem Computer kommt, von Natur aus sehr elektronisch.
Schaffenskraft der Industrie überlassen ist so komfortabel, man muss ja gar nicht üben, wie fein, wie fein.
Ich würde niemals mein Lächeln – so wie Tim Taller – an den Teufel verkaufen.
Damit meine ich: Musik, die industriell produziert wird, ist für mich keine echte Musik und erst recht keine Kunst.
Mir fehlt dabei das spielerische Element, das für mich unbedingt zur Kunst dazugehört – es sei denn, man greift bewusst die Idee der Industrial-Musik auf.
Dafür muss man sich mit Kabellagen, Rackaufbau, Inkompatibilitäten und Softwarelizenzen rumschlagen.
Bei elektronischer Musik braucht man neben einem gewissen Talent vor allem auch technisches Verständnis und ein gutes Gespür dafür. Ich sehe mich deshalb eher als Werkmeister im Sinne des Bauhauses – also der berühmten Kunstschule in Weimar, nicht als Profi-Handwerker oder Baumarktarbeiter – und weniger als reinen Formmeister.
Aber aufgrund eigener Behinderung kann ich nun mal entweder Musik machen, wie auch immer, und echte Musiker sollen lachen, oder aber ewig nach einer Lehrperson fürs bevorzugte Instrument suchen
Na, da bin ich wohl nicht der einzige Musiker mit Behinderung. Vielleicht ist das eine dumme Frage, und es geht mich eigentlich nichts an, aber welche Behinderung hast du?
Ich leide an einer ausgeprägten Psychose. Deshalb hatte ich weiter oben die Anmerkung zum Komponisten und der Meldung an die Krankenkasse gemacht.
die zugleich Ergotherapeutin ist, zumindest mir nicht irgendwann mit einem Geduldfadenriss-Schadenregress kommt und einem Katalog all meiner Störungen.
Bist du eher in einer Ergotherapie oder in einer Musiktherapie? Letztere wirkte auf mich immer wie wildes Trommeln auf Instrumenten, besonders wenn es in der Gruppe stattfand. Aufgrund meines musikalischen Grundverständnisses wollte meine Therapeutin mich deshalb schon in Einzeltherapie nehmen. Allerdings muss sie mir erst zeigen, dass man nicht Moll nach Dur auflöst.
Danke und tschüss. Kling ich ordentlich frustriert? Gut.
So merkwürdig es für dich auch klingen mag – ich empfinde das gar nicht als Frustration, sondern sehe es als berechtigte Kritik an der aktuellen Situation und dem dahinterliegenden System. Wie ich bereits schrieb, fühle ich mich mit meiner Frustration eher wie ein nicht verstandener Kommunist.
Straßenmusiker mit Bluetooth-Boombox im Hinterhalt, worüber sie sich begleiten lassen, bekommen von mir Geld einmal in hundert Jahren.
Das ist heute die moderne Realität: Selbst Straßenmusiker nutzen inzwischen Technik. Warum sollten sie also noch auf der Straße spielen, wenn sie ihre Musik einfach online gegen Bezahlung anbieten könnten – zum Beispiel auf Plattformen wie Jamendo oder YouTube? Das verstehe ich nicht. Außerdem wäre das Verhältnis von Aufwand und Gewinn online wahrscheinlich deutlich besser.