DerOnkel
HCA Elektronik Saiteninstrumente
Moderatorenanmerkung: don't try this at home, kids! Auf Wunsch des Autors möge der Leser bitte zur Kenntnis nehmen, dass es sich um einen Scherz handelt. 
Nachdem der Entwurf der elektronischen Schaltung für Pauline fast ein Jahr in Anspruch genommen hat, habe ich mir auch über die optischen Erscheinung dieser alten Aria Pro II PE-60 BG aus dem Jahre 1983 Gedanken gemacht. Zu so einer exklusiven Schaltung muß natürlich auch eine außergewöhnliche Gestaltung der Oberfläche gehören! Das ist man als Besitzer natürlich auch ihrem Status als Sondermodell schuldig!
Damit "Pauline" wirklich einmalig ist, habe ich mich entschlossen, die Decke mit meinem Konterfei zu "verzieren". Damit wird die Gitarre wirklich einmalig und etwaige Langfinger werden schon im Vorwege wirksam abgeschreckt.
Nachdem ich diverse Gespräche mit verschiedenen Lackierern geführt hatte, war ich von der klassischen Methode nicht wirklich überzeugt. Das gewissen "Etwas", fehlte irgendwie. Da kam mir, sozusagen auf "dienstlichen Wegen", der Zufall zu Hilfe und ich stieß auf den "Piezoelektrischen" Polarisationseffekt (PPe). Er beschreibt, wie durch Azzokupplung verbundene Farbmoleküle im Kristallgitter durch Anlegen einer elektrischen Spannung verformt werden können. Im Endergebnis können die Farbmolekühle sogar unsichtbar gemacht werden!
Alles, was man machen muß, ist das Aufbringen einer bestimmten kristalinen Schicht mit piezoelektrischen Eigenschaften. Das ganze nennt sich dann "Variable Surface Efficiency" (VSE). Interessanterweise lassen sich solche Schichten auch stapeln, sodaß die Darstellung mehrerer Bilder möglich ist (stacked VSE). Letztendlich handelt es sich dann um eine Art kristaliner Bildspeicher, wie er auch schon in den 70er Jahren bei Startrek beschrieben wurde. Nur ist aus der Fiktion mittlerweile Wirklichkeit geworden, wenn auch in etwas anderer Form! Bevor ich jedoch weiter ins Detail gehe, hier das vorläufige Ergebnis ohne und mit eingeschalteter Spannung:

Moderatorenanmerkung: don't try this at home, kids! Auf Wunsch des Autors möge der Leser bitte zur Kenntnis nehmen, dass es sich um einen Scherz handelt.
Nachdem der Entwurf der elektronischen Schaltung für Pauline fast ein Jahr in Anspruch genommen hat, habe ich mir auch über die optischen Erscheinung dieser alten Aria Pro II PE-60 BG aus dem Jahre 1983 Gedanken gemacht. Zu so einer exklusiven Schaltung muß natürlich auch eine außergewöhnliche Gestaltung der Oberfläche gehören! Das ist man als Besitzer natürlich auch ihrem Status als Sondermodell schuldig!
Damit "Pauline" wirklich einmalig ist, habe ich mich entschlossen, die Decke mit meinem Konterfei zu "verzieren". Damit wird die Gitarre wirklich einmalig und etwaige Langfinger werden schon im Vorwege wirksam abgeschreckt.
Nachdem ich diverse Gespräche mit verschiedenen Lackierern geführt hatte, war ich von der klassischen Methode nicht wirklich überzeugt. Das gewissen "Etwas", fehlte irgendwie. Da kam mir, sozusagen auf "dienstlichen Wegen", der Zufall zu Hilfe und ich stieß auf den "Piezoelektrischen" Polarisationseffekt (PPe). Er beschreibt, wie durch Azzokupplung verbundene Farbmoleküle im Kristallgitter durch Anlegen einer elektrischen Spannung verformt werden können. Im Endergebnis können die Farbmolekühle sogar unsichtbar gemacht werden!
Alles, was man machen muß, ist das Aufbringen einer bestimmten kristalinen Schicht mit piezoelektrischen Eigenschaften. Das ganze nennt sich dann "Variable Surface Efficiency" (VSE). Interessanterweise lassen sich solche Schichten auch stapeln, sodaß die Darstellung mehrerer Bilder möglich ist (stacked VSE). Letztendlich handelt es sich dann um eine Art kristaliner Bildspeicher, wie er auch schon in den 70er Jahren bei Startrek beschrieben wurde. Nur ist aus der Fiktion mittlerweile Wirklichkeit geworden, wenn auch in etwas anderer Form! Bevor ich jedoch weiter ins Detail gehe, hier das vorläufige Ergebnis ohne und mit eingeschalteter Spannung:

Man sieht, daß mein Konterfei komplett verschwindet. Der PPe arbeitet also vollständig!
Der Effekt selber wurde in den letzten Jahren kommerziell in verschiedenen Display-Typen verwendet. Hier waren es hauptsächlich Fernsehgeräte, die nach dem Projektionsverfahren arbeiteten. Da die Geräte jedoch sehr teuer waren, blieb der große Erfolg leider aus.
Wie es geht
Wie funktioniert jetzt der PPe? Nun, zunächst ist ein kristaliner Farbträger gesucht. Erstaunlicherweise gibt es hier eine bestechend einfach Lösung: Rapsöl! Der PPe ist für dieses wirklich universelle Öl nur noch eine weitere, wenn auch erstaunliche Anwendung, die allerdings nur möglich wird, wenn drei Effekte in geeigneter Form kombiniert werden.
Bei der Beschaffung ist darauf zu achten, ein Öl mit möglichst hohem Gehalt an gesättigten Omega-3-Fettsäuren zu erhalten. Öle mit ungesättigten Säuren sind leider nicht geeignet!
Wird das Öl erhitzt, so zerfallen die Säuremoleküle in je zwei ungesättigte Säuren. Dieses unstabile Zwischenprodukt wird durch Anlegen einer elektrischen Spannung im Molekülverbund neu ausgerichtet sodas die bindungsinaktive Seite der Moleküle zur positiven elektrischen Ladung hin ausgerichtet wird. Auf der anderen Seite bildet sich jetzt die, von den Farbstoffen bekannte, Azzokupplung aus, welche phsikalisch auf der sogenannten schwachen Wechselwirkung beruht. Dadurch erhält man wieder ein stabiles Säuremolekül, deren beiden Teile jedoch flexibel miteinander verbunden sind.
Da die bindungsinaktive Seite des Moleküls immer noch elektrisch negativ geladen ist, spricht man auch von einem "monopolaren" Stoff. Jetzt setzt der auch in der Halbleiterei bekannte Effekt der Ladungsverschiebung ein. Am Ende dieses Prozesses liegt wieder ein stabiler elektrischer Diplo vor. Diese Eigenschaft ist von entscheidender Bedeutung, denn nur sie ermöglicht später die Ausbildung eines Kristallgitters.
Die Vorbereitung
Der erste Arbeitsschritt besteht aus dem Aufbringen eine Ölschicht auf der Grundfläche. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß eine gleichmäßige Dicke erreicht wird, sonst kommt es später zu lokalen Unschärfebereichen, den sogenannten Soft-Spots.
Nachdem das Öl getrocknet ist, kommt der zweite Schritt: Die Ölschicht (inkl. des Trägermaterials) muß erhitzt werden. Ab einer Temperatur von 86°C beginnt der Zerfall der Säuremoleküle, der sich mit weiter steigender Temperatur beschleunigen läßt. Je nach größer der Fläche tritt nach 10 bis 15 Minuten ein Sättigungseffekt ein, da dann alle Moleküle aufgespalten wurden.
Nun wird die elektrische Spannung angelegt. Das ist jedoch nicht ganz so einfach, denn eine Ölschicht läßt sich leider nicht besonders gut kontaktieren. Da es jedoch nicht auf das Anlegen einer Spannung, sondern auf ein elektrisches Feld ankommt, kann man sich mit einem kleinen Trick behelfen: Bringt man das Trägermaterial (hier den Korpus der Gitarre) in ein elektrisches Feld, so entsteht im Korpus ein entgegengerichtetes Feld als deren Folge dort eine elektrische Spannung gemessen werden kann. Der ursächliche Effekt heißt Influenz (Ladungstrennung). Das nächste Bild zeigt das Prinzip:
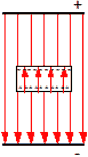
Der Effekt selber wurde in den letzten Jahren kommerziell in verschiedenen Display-Typen verwendet. Hier waren es hauptsächlich Fernsehgeräte, die nach dem Projektionsverfahren arbeiteten. Da die Geräte jedoch sehr teuer waren, blieb der große Erfolg leider aus.
Wie es geht
Wie funktioniert jetzt der PPe? Nun, zunächst ist ein kristaliner Farbträger gesucht. Erstaunlicherweise gibt es hier eine bestechend einfach Lösung: Rapsöl! Der PPe ist für dieses wirklich universelle Öl nur noch eine weitere, wenn auch erstaunliche Anwendung, die allerdings nur möglich wird, wenn drei Effekte in geeigneter Form kombiniert werden.
Bei der Beschaffung ist darauf zu achten, ein Öl mit möglichst hohem Gehalt an gesättigten Omega-3-Fettsäuren zu erhalten. Öle mit ungesättigten Säuren sind leider nicht geeignet!
Wird das Öl erhitzt, so zerfallen die Säuremoleküle in je zwei ungesättigte Säuren. Dieses unstabile Zwischenprodukt wird durch Anlegen einer elektrischen Spannung im Molekülverbund neu ausgerichtet sodas die bindungsinaktive Seite der Moleküle zur positiven elektrischen Ladung hin ausgerichtet wird. Auf der anderen Seite bildet sich jetzt die, von den Farbstoffen bekannte, Azzokupplung aus, welche phsikalisch auf der sogenannten schwachen Wechselwirkung beruht. Dadurch erhält man wieder ein stabiles Säuremolekül, deren beiden Teile jedoch flexibel miteinander verbunden sind.
Da die bindungsinaktive Seite des Moleküls immer noch elektrisch negativ geladen ist, spricht man auch von einem "monopolaren" Stoff. Jetzt setzt der auch in der Halbleiterei bekannte Effekt der Ladungsverschiebung ein. Am Ende dieses Prozesses liegt wieder ein stabiler elektrischer Diplo vor. Diese Eigenschaft ist von entscheidender Bedeutung, denn nur sie ermöglicht später die Ausbildung eines Kristallgitters.
Die Vorbereitung
Der erste Arbeitsschritt besteht aus dem Aufbringen eine Ölschicht auf der Grundfläche. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß eine gleichmäßige Dicke erreicht wird, sonst kommt es später zu lokalen Unschärfebereichen, den sogenannten Soft-Spots.
Nachdem das Öl getrocknet ist, kommt der zweite Schritt: Die Ölschicht (inkl. des Trägermaterials) muß erhitzt werden. Ab einer Temperatur von 86°C beginnt der Zerfall der Säuremoleküle, der sich mit weiter steigender Temperatur beschleunigen läßt. Je nach größer der Fläche tritt nach 10 bis 15 Minuten ein Sättigungseffekt ein, da dann alle Moleküle aufgespalten wurden.
Nun wird die elektrische Spannung angelegt. Das ist jedoch nicht ganz so einfach, denn eine Ölschicht läßt sich leider nicht besonders gut kontaktieren. Da es jedoch nicht auf das Anlegen einer Spannung, sondern auf ein elektrisches Feld ankommt, kann man sich mit einem kleinen Trick behelfen: Bringt man das Trägermaterial (hier den Korpus der Gitarre) in ein elektrisches Feld, so entsteht im Korpus ein entgegengerichtetes Feld als deren Folge dort eine elektrische Spannung gemessen werden kann. Der ursächliche Effekt heißt Influenz (Ladungstrennung). Das nächste Bild zeigt das Prinzip:
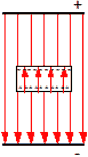
Ein solcher Kondensator läßt sich leicht und preiswert durch mit Alufolie bespanntes Sperrholz realisieren. Die Höhe der Spannung ist nicht besonders kritisch. Hier gilt auch wieder: Je größer, desto schneller! Ab 30 Volt sind akzeptable Zeiten für die Ausrichtung der Moleküle zu erwarten. Für einen normalen Korpus einer Elektrogitarre kann man dann mit Prozesszeiten von 14 bis 40 Minuten rechnen. Während dieser Zeit ist ein leichter Stromfluß (1µA - 4µA) festzustellen. Sind alle Moleküle ausgerichtet, fließt kein Strom mehr. Die Ölschicht ist jetzt photoaktiv und kann belichtet werden.
Die Belichtung
Das Aufbringen des Bildes ist denkbar einfach: Mit Hilfe eines Diaprojektors oder Beamers wird das gewünschte Motiv auf die Oberfläche projiziert. Dabei werden die Teile der einzelnen Säuremoleküle durch den Spin der Photonen in Schwingungen versetzt und verdrehen sich umeinander. Hier die eingefärbte Aufnahme eines Elektronenmikroskopes, die ich bei uns im Labor der physikalischen Analyse machen konnte:

Die Belichtung
Das Aufbringen des Bildes ist denkbar einfach: Mit Hilfe eines Diaprojektors oder Beamers wird das gewünschte Motiv auf die Oberfläche projiziert. Dabei werden die Teile der einzelnen Säuremoleküle durch den Spin der Photonen in Schwingungen versetzt und verdrehen sich umeinander. Hier die eingefärbte Aufnahme eines Elektronenmikroskopes, die ich bei uns im Labor der physikalischen Analyse machen konnte:

Die Art der Torsion ist dabei ein Charakteristikum des verursachenden Lichtstromes. Auf diese Weise werden die einzelnen Moleküle quasi mit einer Farbe programmiert. Durch die Torsion bilden sich zwischen den beiden Molekülteilen Wechselwirkungen aus, die sich in einem optischen Reflexionsfaktor äußern. Dieser Vorgang wird als "Non Aprilare Photo Torsion" (NAPT) bezeichnet (aprilar von lat. aperire = öffnen). Es wird exakt Licht der Wellenlänge reflektiert, welche die Torsion verursacht hat.
Die Belichtung erfolgt relativ schnell nur leider ist das Ergebnis (noch) nicht stabil. Verändert man die Belichtung, so werden die Moleküle sofort "umprogrammiert".
Das Bild wird gespeichert
Als nächstes muß daher die Temperatur wieder unter die magische Grenze von 86°C gesenkt werden. Der Energiegehalt der Moleküle sinkt dabei und sie verlieren die Eigenschaft mechanische Schwingungen auszuführen. Dadurch wird der programmierte Zustand quasi "eingefroren"! Wird die Temperatur wieder erhöht, so setzt sofort ein erneuter Belichtungsprozess ein.
Kristall oder nicht Kristall?
Zum Schluß geht es nur noch darum, den gewünschten kristalinen Zustand zu erreichen, was erstaunlich einfach ist: Man schaltet einfach die elektrische Spannung aus! Jetzt werden die Moleküle so im Raum neu geordnet, daß die negative Seite eines Molküls an der positive Seite eines anderen anliegt. Die benachbarten Ketten ordnen sich genau anders herum.
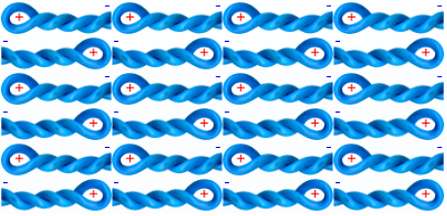
Die Belichtung erfolgt relativ schnell nur leider ist das Ergebnis (noch) nicht stabil. Verändert man die Belichtung, so werden die Moleküle sofort "umprogrammiert".
Das Bild wird gespeichert
Als nächstes muß daher die Temperatur wieder unter die magische Grenze von 86°C gesenkt werden. Der Energiegehalt der Moleküle sinkt dabei und sie verlieren die Eigenschaft mechanische Schwingungen auszuführen. Dadurch wird der programmierte Zustand quasi "eingefroren"! Wird die Temperatur wieder erhöht, so setzt sofort ein erneuter Belichtungsprozess ein.
Kristall oder nicht Kristall?
Zum Schluß geht es nur noch darum, den gewünschten kristalinen Zustand zu erreichen, was erstaunlich einfach ist: Man schaltet einfach die elektrische Spannung aus! Jetzt werden die Moleküle so im Raum neu geordnet, daß die negative Seite eines Molküls an der positive Seite eines anderen anliegt. Die benachbarten Ketten ordnen sich genau anders herum.
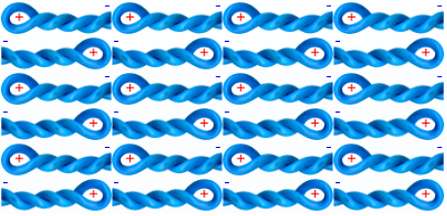
Damit haben sich die Dipole ausgerichtet. Man erhält einen sogenannten "Pseudokristall", der durch die Kettenstruktur kristaline Schichten bildet. Diese lassen sich durch Druck leicht gegeneinander verschieben.
Nachdem die Ölschicht kristalisiert ist, ist der Prozess abgeschlossen, was deutlich an dem neuen Bild auf der Trägeroberfläche zu erkennen ist. Der Aggregatzustand der Schicht ist als absolut stabil zu betrachten, solange keine Temperatureinflüssen zu verzeichnen sind.
Arbeiten mit VSE
Legt man nach der Belichtung eine Spannung an die Kristallschicht, so sorgt das entstehende elektrische Feld für eine Neuausrichtung der Dipole, die sich um Extremfall um maximal 90° aus der Ausgangslage wegdrehen. Durch diesen Vorgang verliert die Kristallschicht ihr Reflexionsverhalten und gibt damit den Blick auf die darunterliegende Schicht frei.
Wird die Spannung wieder ausgeschaltet, so fallen die Kristalldipole wieder in ihre Ausgangslage zurück. Das gespeicherte Bild wird wieder sichtbar.
Netterweise erolgt die Ansteuerung absolut hochohmig, da die Kristallschichten quasi wie ein Kondensator arbeiten. Es fließt also nicht wirklich ein bemerkenswerter Strom. Eine normale 9 Volt-Batterie sollte also mehrere Jahre reichen.
Ich habe mittlerweile 2 aktive Schichten aufgebracht, die unter dem Tailpiece mit insgesamt 3 Steuerelektroden versehen wurden. So ist es möglich, beide Schichten getrennt anzusteuern.
Mit Hilfe einer kleinen Ansteuerelektronik kann über ein Potentiometer ein stufenloser Übergang zwischen den drei Zuständen Hintergrund, Bild 1 und Bild 2 realisert werden. Hier der Übergang vom Hintergrund nach Bild 1:

Danach folgt der Übergang von Bild 1 nach Bild 2. Auf diese Weise konnte ich auch die Tochter auf Pauline verewigen. Manchmal muß man die Dinge eben durch Zwei teilen!

Fazit
Ich bin sehr erstaunt, wie leicht sich dieses Verfahren aus der Bildtechnik auf die Anwendung auf Oberfläche einer Gitarre anwenden ließ. Das Ergebnis ist unbestreitbar beeindruckend!
Natürlich ist diese Methode nicht auf eine Gitarre beschränkt; sie läßt sich vielmehr auf fast allen Oberflächen anwenden!
Da hier eine neue Anwendung von PPe und VSE vorliegt, habe ich eine entsprechende Anmeldung beim europäischen Patentamt vorgenommen, das nun die entsprechenden Vorgänge in die Wege leiten wird. Am Ende wird dann (hoffentlich) ein global gültiges Patent stehen, welches mir die Finanzierung der einen oder anderen alten Aria wohl erleichtern wird.
Ulf
Nachdem die Ölschicht kristalisiert ist, ist der Prozess abgeschlossen, was deutlich an dem neuen Bild auf der Trägeroberfläche zu erkennen ist. Der Aggregatzustand der Schicht ist als absolut stabil zu betrachten, solange keine Temperatureinflüssen zu verzeichnen sind.
Arbeiten mit VSE
Legt man nach der Belichtung eine Spannung an die Kristallschicht, so sorgt das entstehende elektrische Feld für eine Neuausrichtung der Dipole, die sich um Extremfall um maximal 90° aus der Ausgangslage wegdrehen. Durch diesen Vorgang verliert die Kristallschicht ihr Reflexionsverhalten und gibt damit den Blick auf die darunterliegende Schicht frei.
Wird die Spannung wieder ausgeschaltet, so fallen die Kristalldipole wieder in ihre Ausgangslage zurück. Das gespeicherte Bild wird wieder sichtbar.
Netterweise erolgt die Ansteuerung absolut hochohmig, da die Kristallschichten quasi wie ein Kondensator arbeiten. Es fließt also nicht wirklich ein bemerkenswerter Strom. Eine normale 9 Volt-Batterie sollte also mehrere Jahre reichen.
Ich habe mittlerweile 2 aktive Schichten aufgebracht, die unter dem Tailpiece mit insgesamt 3 Steuerelektroden versehen wurden. So ist es möglich, beide Schichten getrennt anzusteuern.
Mit Hilfe einer kleinen Ansteuerelektronik kann über ein Potentiometer ein stufenloser Übergang zwischen den drei Zuständen Hintergrund, Bild 1 und Bild 2 realisert werden. Hier der Übergang vom Hintergrund nach Bild 1:

Danach folgt der Übergang von Bild 1 nach Bild 2. Auf diese Weise konnte ich auch die Tochter auf Pauline verewigen. Manchmal muß man die Dinge eben durch Zwei teilen!

Fazit
Ich bin sehr erstaunt, wie leicht sich dieses Verfahren aus der Bildtechnik auf die Anwendung auf Oberfläche einer Gitarre anwenden ließ. Das Ergebnis ist unbestreitbar beeindruckend!
Natürlich ist diese Methode nicht auf eine Gitarre beschränkt; sie läßt sich vielmehr auf fast allen Oberflächen anwenden!
Da hier eine neue Anwendung von PPe und VSE vorliegt, habe ich eine entsprechende Anmeldung beim europäischen Patentamt vorgenommen, das nun die entsprechenden Vorgänge in die Wege leiten wird. Am Ende wird dann (hoffentlich) ein global gültiges Patent stehen, welches mir die Finanzierung der einen oder anderen alten Aria wohl erleichtern wird.
Ulf
Moderatorenanmerkung: don't try this at home, kids! Auf Wunsch des Autors möge der Leser bitte zur Kenntnis nehmen, dass es sich um einen Scherz handelt.
- Eigenschaft

 Wo kann man so etwas machen lassen? Und wie viel kostet das?
Wo kann man so etwas machen lassen? Und wie viel kostet das? nun möcht ich dem onkel aber nichts unterstellen, wenn das wirklich funktioniert ist das ne verdammt geile sache - in meinen ohren klingts aber doch nur nach star-trek...
nun möcht ich dem onkel aber nichts unterstellen, wenn das wirklich funktioniert ist das ne verdammt geile sache - in meinen ohren klingts aber doch nur nach star-trek... 
