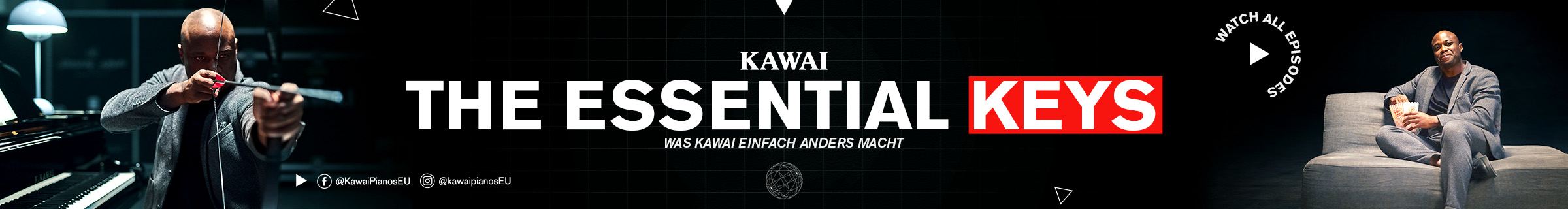In meiner "aktiv(-er-)en" Zeit hatte ich ein ähnliches, vielleicht vergleichbares Hobby-Projekt, dass aber Reproduzierbarkeit nicht verdammt oder infragestellt, sondern feiert
Wie ich bereits versucht habe zu erklären, geht es mir darum, die verschiedenen Variationsmöglichkeiten der Programmdurchläufe zu nutzen, um eine Verbindung zwischen dem Konzept multipler Formen und einem individuellen Kunstwerk herzustellen. Dadurch soll ein Mehrwert geschaffen werden, der an den Hörer weitergegeben wird.
Andere fanden für meine Hörbeispiele gern wenig schmeichelhafte Attribute für mechanisch oder tot, das hat mich angesichts des Aufwands, den ich trieb, zuweilen bis auf die Ebene von Einzelnoten, schon etwas geknickt.
Für meine musikalischen Ergebnisse gab es unterschiedliche Bezeichnungen, wie zum Beispiel „Kakophonie in Violett“. Erfolg ist nicht jedem Komponisten einfach in den Schoß gelegt, und nicht jeder Mensch versteht das Spiel – auch wenn es beruflich als ernsthaftes Spiel mit Kunst und Musik gilt.
So tot fand ich selber nicht, was ich produzierte! *Flunschzieh* ;-) Ohren, die immer wieder das selbe falsche hören, gewöhnen sich leicht daran. Das ist tückisch.
Ich kann das Problem gut nachvollziehen. Es gibt jedoch noch einen weiteren Aspekt: Die Musik der Avantgarde ist zum Beispiel nicht für jeden leicht zugänglich. Wenn man etwas nicht versteht, wird es oft umso langweiliger.
In dem Projekt ging es um eine textförmige Sprache/Notation, die die Beschränkungen des MIDI-Protokolls überwindet, da es für bestimmte Zwecke geeignet erscheint, kam es ja aus dem Wunsch nach maschineller Interoperabilität statt nach Notation.
In diesem Sinne könnte man einen Programmtext verwenden, um dein Ziel zu erreichen. Auch wenn ich die Begrenztheit der MIDI-Notation sehe, war sie dennoch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung. Wenn ich diese Aufgabe übernehmen würde, würde ich momentan auf SuperCollider oder Csound zurückgreifen.
dass SonicPi/SoundCollider/TidalCycles/u.a. lästigerweise an eine grafische Benutzoberfläche gebunden waren, "Klickibunti", dachte ich vielleicht etwas überheblich, mir nicht nüchtern funktional und kryptisch genug, um mich abzugrenzen, wofür zudem mein RaspberryPi zu langsam war.
Ja, ich weiß, wir Computer-Nerds sind meist echte Masochisten und suchen gerne die Herausforderung. Trotzdem sollte man sich die Arbeit – oder besser gesagt das Hobby – nicht unnötig schwer machen. Mir ist klar, dass es hier mehr auf den Weg als auf das Ziel ankommt, aber trotzdem…
Und, dass ich ein Projekt suchte, Python zu lernen.
Python war die zweite Programmiersprache, die ich gelernt habe – nach QBASIC. Der Übergang von BASIC zu Python fiel mir besonders wegen der objektorientierten Programmierung schwer. Mittlerweile beschäftige ich mich mit Clojure und der datenorientierten Programmierung. Besonders spannend finde ich, dass man mit Clojure und Overtone Musik machen kann – und das sogar ganz ohne grafische Benutzeroberfläche.
"Fertige" Musik aus Notenbüchern zu übersetzen, zu reproduzieren (und dabei zu "interpretieren", allerdings s.u.), sollte mir mehr Spaß machen als Beispiel-Quelltexte für Python irgendwo herunterzuladen, abzutippen und zur Ausführung zu bringen.
Wenn man großes Interesse daran hat, etwas zu lernen, lernt man automatisch schneller und besser. Ich zum Beispiel hatte früher immer Schwierigkeiten mit der englischen Sprache, weil ich keinen wirklichen Nutzen darin sah. Heute komme ich ohne Englisch kaum noch aus, denn alle Foren und die gesamte Dokumentation sind auf Englisch. Dadurch habe ich letztendlich doch noch Englisch gelernt.
Meine Fragestellung war, wie sich die Klangdomäne und die Tondomäne notationstechnisch, sprachlich, d.h. syntaktisch-semantisch unter einen Hut bringen lässt.
Wie bereits erwähnt, beschäftige ich mich autodidaktisch mit Musik und Kunst – zwar hauptsächlich als Hobby. Dabei möchte ich mich vertieft mit der Semiotik und Semantik in beiden Bereichen auseinandersetzen. Mein Fokus liegt dabei auf den Begriffen „Gestaltung in Zeit und Raum“. In diesem Zusammenhang finde ich es besonders interessant zu untersuchen, welche semiotischen Elemente diese Gestaltung prägen und welche Bedeutungen (Semantiken) ihnen dabei zugeschrieben werden.
Die Klangdomäne umfasst das gesamte Spektrum zwischen Sinuston und Rauschen.
Wie ich bereits erwähnt habe, möchte ich mich später noch mit der Semiotik der Zeitgestaltung beschäftigen. In diesem Zusammenhang wird es spannend sein, das Spektrum zwischen Sinustönen und Rauschen genauer zu betrachten. Meines Wissens hat beispielsweise Karlheinz Stockhausen mit Sinustönen und Impulstönen gearbeitet, während die musique concrète ihren Ausgangspunkt im Geräusch nimmt. In gewisser Weise sollen diese verschiedenen Klangarten den Zeitraum füllen und gestalten.
Menschliche Sprache, da zu kompliziert, außen vor gelassen, aber Tierstimmen sind durchaus drin, sogar Sturmgewehrsalven
Für dieses Thema ist es wichtig, die Semantik der zuvor genannten Elemente zu betrachten. Die menschliche Sprache ist besonders semantisch geprägt, da sie die Grundlage für Bedeutung bildet. Aber auch andere Geräusche tragen eine semantische Bedeutung, was insbesondere in der Musik Concrete eine große Rolle spielt.
das mir selber so sehr Angst gemacht hatte, sich derart echt anhörte, dass ich Notat und Rendering umgehend gelöscht hatte.
Ich bezeichne diesen Vorgang gerne als „semantischen Kurschluss“. Er tritt ein, wenn die semantische Bedeutung gegenüber der Betrachtung der semiotischen Gestalt in den Vordergrund rückt. Dadurch endet das Musikalische, und das Sprachliche gewinnt an Bedeutung.
Dieses Phänomen stellt vor allem dann ein Problem dar, wenn Musik von Maschinen verarbeitet wird. Wie ich bereits an anderer Stelle erwähnt habe, liegt mein Interesse irgendwo an der Schnittstelle von Informatik (insbesondere Künstliche Intelligenz), Musik, Kunst und Philosophie.
Die Domäne umfasst Stimmen, Instrumente, Spielweisen, Artikulation,
Wir sind ja bereits auf das Thema Stimmen eingegangen, insbesondere auf das Instrument und seine Spielweise beziehungsweise Artikulation. Was mich dabei beschäftigt, ist die Frage, warum wir stets vom Instrument selbst ausgehen und nicht von einem Kontinuum von Tönen – etwa von reinen Sinustönen. Warum betrachten wir den Klang des Instruments immer als eine einzelne, abgeschlossene Einheit (Monade), anstatt ihn als Teil eines kontinuierlichen Spektrums von Tönen zu sehen?
aber sogar (sowas wie) Raumhall, denn der gehört mit zur Akustik.
Ich bin ein großer Freund von Raumhall, auch wenn ich ihn meist künstlich erzeuge. Denn erst durch den Hall erhält die Musik einen besonderen Raum und Glanz. Dabei frage ich mich oft: Wie weit kann man mit dem Reverb gehen, bis er selbst zum bestimmenden Element wird – quasi zum eigenen Instrument?
Die Klangdomäne stellt grob das dar, was am Synthesizer einstellbar ist, bevor der Mensch an den Tasten die erste Taste drückt.
Das bringt mich zu einer weiteren Frage: Wie unterscheidet man eigentlich den Klang eines Instruments vom Klang einer Komposition? Wo liegt der Unterschied zwischen dem musikalischen Mikrokosmos und Makrokosmos? Bei traditioneller Musik mag das noch relativ einfach sein – hier gilt oft deine Regel: der Klang vor und nach dem Tastendruck. Doch wie verhält es sich bei elektronischer Musik, die häufig eine Mischung aus Sinustönen und Geräuschen darstellt?
Die Tondimension der Musik ist die Melodie, Harmonie, Rhythmus, Tempo, Dynamik.
Ich möchte hier eine Unterscheidung zwischen primären Ton-Dimensionen und Klang-Dimensionen einführen. Der Ton lässt sich durch seine Frequenzen definieren. Es ist für mich wichtig, den Ton als eine Menge von Frequenzen zu betrachten, insbesondere im Hinblick auf den letzten Punkt, bei dem ich die Unterscheidung zum Instrument hinterfragt habe – dabei spielen auch die Amplituden dieser Frequenzen eine Rolle.
Klang-Dimensionen umfassen für mich hingegen Melodie und Harmonie – oder anders gesagt Harmonie und Kontrapunkt –, die traditionell die Makrostruktur der Musik prägen.
Eine weitere wichtige Klang-Dimension bilden Rhythmus und Tempo. Interessanterweise werden diese in der traditionellen Musiktheorie meiner Beobachtung nach eher als weniger bedeutsam angesehen. So konnte ich weder in meiner Stadtbibliothek noch in der Universitätsbibliothek ein umfassendes Buch zum Thema Rhythmus finden. Zudem wird das Tempo oft in BPM und Notenlängen getrennt behandelt, was ich zumindest verwirrend finde. Vielleicht kann hier jemand für Klarheit sorgen.
Die Tondomäne stellt mehr oder weniger das da, was Notenstecher üblicherweise aufs Papier bringen. bestimmte Dinge auch hier ausgenommen, dafür anderes expliziter:
Ich glaube, du meinst hier eher die Klangdomäne – also Elemente wie Harmonie, Melodie, Rhythmus und Tempo. Es wäre wichtig zu klären, wie sich die Gestalt von Ton und Klangdomäne beschreiben lässt. Mit einer solchen Beschreibungstechnik könnte man auch das Thema Notation besser verstehen und lösen.
Legatobögen ebenso wenig, aber stative relative Tonkürzungen-/verlängerungen. Rallentando etc. machten Tempogradientennotation Platz, und so weiter.
Dies sind meiner Erfahrung nach Elemente, die oft in der traditionellen Notation benutzt werden – aber zum Beispiel in der MIDI-Aufzeichnung keine Entsprechung haben. Eine interessante Frage ist hier zum Beispiel auch, ob musikalische Notenverzierungen es dem Dirigenten und den Instrumentalisten ermöglichen, die Partitur besser zu lesen als in der ausgeschriebenen Form.
Jeder Beat kann tempodynamisch gestaltet werden, wenn man sich diese Mühe machen will.
Ein interessanter Aspekt ist, dass heute jedes Element einer Komposition sehr genau geplant und gestaltet werden kann. Die entscheidende Frage dabei ist jedoch, wie präzise diese Ausarbeitung sein muss, damit der künstlerische Gedanke für den Zuhörer wirklich verständlich und erlebbar wird. Ein gutes Beispiel dafür sind die Player-Piano-Kompositionen von Kornell Nankarow, der diesen Prozess bis zur Perfektion – oder sogar bis ins Extrem – getrieben hat.
Wie lässt sich nun beides in anderthalb Sprachen ausdrücken? Das war die Frage, die sich mir stellte.
Genau, deshalb möchte ich nach einer zeitgemäßen Form der Notation und Partitur fragen.