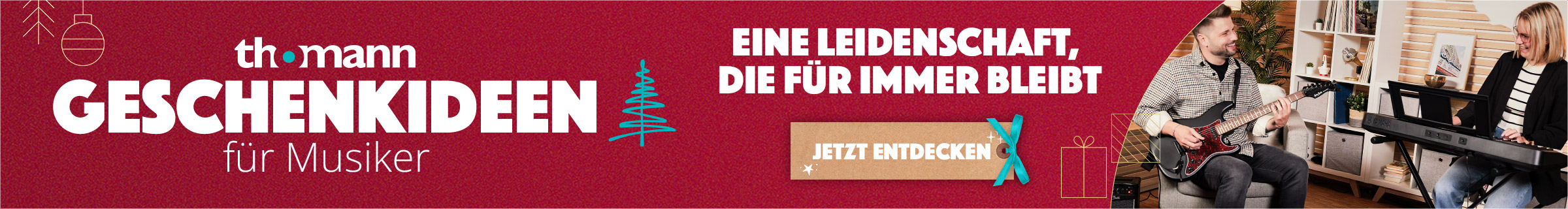Hallo!
Ich glaube da eher, dass man nach Absingen der Heptatonik nur ungern (anfangs ohne zu wissen, warum) auf dem Leitton, der ja zum Grundtopn "drängt", zu verharren vermag und daher sein kleines Heil im Grundton findet, die "Auflösung" quasi (ohne auch zu wissen, was das genau ist).
Da denkt man anfangs nicht darüber nach, man bekommt es so tradiert. Das Gefühl (da fehlt noch einer!) übernimmt man dann für die Theorie. Wie es vor 1000 Jahren war, weiss man nicht, wenn man so im hiesigen Kulturkreis die erste Musik vermittelt bekommt.
Die Frage ist, in wie weit man das Gefühl an die Theorie anpasst oder umgekehrt. Wenn ich Bebop oder Gustav Mahler nehme, bekomme ich evtl. eine andere Musiktheorie, als wenn ich Techno nehme (Takt: es gibt 4/4, Thema Takt abgehakt).
Andererseits: Der Mensch vermag Dinge zu tun, die abseits seines Gefühls (sei tradiert, intrinsisch oder wasuachimmer) ist, aber erhellend sind und ein Licht auf unsere Denk- und Hörgewohnheiten werfen. Wer sich nur im Bereich aufhält, wo er sich wohlfühlt, entwickelt sich nicht weiter.
Grüße
Roland
PS:
Achja: Man sagt "die Halbtonschritte liegen zwischen III/IV und VII/VIII" (so brav in der Schule gelent); andererseits sagt man später gerne, dass nicht die Halb- und Ganztonschritte für die Charakteristik der verschiedenen Modi verantwortlich ist, sondern die jeweiligen Intervalle zum Grundton, sprich: Wie ist die Terz, Quinte, Septime?
Insofern unlogisch, für die Intervalle zum Grundton brauch die VIII nicht, ist ja automagisch eine Oktave.