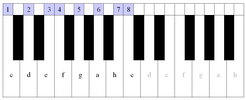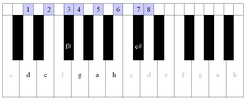Umgekehrt besteht gerade wegen der schnellen Gewöhnung des Gehörs auch immer die Gefahr, dass man sich an falsch Gespieltes sofort gewöhnt. Da wachsen junge Menschen auf, die jahrelang aus dem Radio nur exakte Töne gewohnt sind - und trotzdem finden sie dann ihre ungezielt verzogenen Noten auf der Gitarre subjektiv als "richtig" oder "nicht falsch". , sobald sie sich nur einige Tage dran gewöhnt haben. Das sagt eigentlich alles darüber, wie schnell sich ein Tonempfinden als "richtig", "falsch" oder "anders" für jeden einzelnen Menschen einstellen kann.
Ich denke da kommt allerdings noch hinzu, dass man beim Spielen oft anders hört, als wenn man einem anderen zuhört. Wenn jemand entgegen seiner Wahrnehmung ungenau spielt ist es oft hilfreich, ihm eine Aufnahme des Gespielten vorzuspielen, so dass er die Möglichkeit hat sich selbst "von außen" zuzuhören.
(das hilft insbesondere bei schlechtem Rhythmusgefühl)
Ansonsten ist aber auch fraglich, was nun "exakte Töne" sind: Schon allein bei den Terzen gibt es sehr unterschiedliche nachvollziehbare Intonationsvarianten, die teilweise sehr stark voneinander abweichen, hier mal nach Intervallgröße geordnet:
- Septimale kleine Terz (7:6, 267 Cent)
- Pythagoreische kleine Terz (32:27, 294 Cent)
- 12-Stufige kleine Terz (2^(3/12):1, 300 Cent)
- Natürliche kleine Terz (6:5, 316 Cent)
- Neutrale Terz ("Hälfte der Quintdistanz", genaue Größe ist aber eher individuell)
- Natürliche große Terz (5:4, 386 Cent)
- 12-Stufige große Terz (2^(4/12):1, 400 Cent)
- Pythagoreische große Terz (81:64, 408 Cent)
- Septimale große Terz (9:7, 435 Cent)
...wenn es jemandem also gefällt, seine Terzen auf der Gitarre anders zu intonieren muss das nicht unbedingt falsch sein, allerdings stimme ich dir im Grunde genommen zu, und "schiefe" Bendings haben oft nicht viel mit bewusstem Spiel zu tun.