K
Klänger am Proggen
Gesperrter Benutzer
- Zuletzt hier
- 03.09.25
- Registriert
- 23.08.24
- Beiträge
- 60
- Kekse
- 148
View: https://m.youtube.com/watch?v=7PVOVYwVAi4&pp=ygULY3VzaCBjaG9yZHM%3D
Das Video wurde mir in anderem Zusammenhang empfohlen, außerhalb dieses Boards, als ich eine Systematik leitereigener Akkorde schuf ... vorstellte ... und unter gleichmäßigem Rühren in den Ausguss ...
Zunächst für alle, die noch genervt sind vom Thread von letzter Woche. Dieser wird hier anders laufen, hoffe ich.
Danke dafür, dass ihr beim eigentlichen Thema bleibt, ich schreib mir das nur von der Seele, da ich die wertvolle Zeit einiger auf dem Gewissen hab.
Mein PDF im kürzlich gestarteten, und bald präventiv geschlossenen Thread wurde von euch beurteilt als, hier mal in meinen eigenen Worten , ein Sammelsurium unkontrolliert amoklaufender Verstandspirouetten, kognitiver Rundumüberschläge und beherzt durchramponierter Landung im Aus. Scheißchaos, das zu verstehen tragischerweise heißt, anderen als Crackpot zu erscheinen.
, ein Sammelsurium unkontrolliert amoklaufender Verstandspirouetten, kognitiver Rundumüberschläge und beherzt durchramponierter Landung im Aus. Scheißchaos, das zu verstehen tragischerweise heißt, anderen als Crackpot zu erscheinen.
Wenn er auch in ernsthafter Absicht gestartet wurde: Man mag sich wundern, es war nicht auf dem Reißbrett entstanden. Sondern ist aus einigen falsch über halb, vielleicht auch mal auch ganz in Ordnung verstandenen Quellen kulminiert. Dieses Video gehört sicher zu den halbverstandenen.
Verstanden wurden offenbar auch mehr nur gefühlt als tatsächlich Ziegenrückers ABC, Allg. Musiklehre einfach erklärt, Hempels Harmonielehre, eine Jazz-Harmonielehre (Irgenein Sikora? möglich.), die beiden enzyklopädischen, diese natürlich nur selektiv verarbeiteten Bände Harmonielehre und Lexikon der musikalischen Form eines Reinhard Amon, zuletzt angefangen Rock&Jazz Harmony von Mathias Löffler ...
Alles mögliche, Literatur, die über Jahre gesammelt teilweise in meinem Bücherregal steht, teilweise aus der Stadtbücherei ausgeliehen wurde, und doch jetzt freundlicherweise vom Team dediziert mir empfohlen. Als Literatur empfohlen zu kriegen, was ich meinte gelesen zu haben ... bitter. Fazit: Nichts gelernt. Spätestens hier ist mir klar geworden, man kann ein Haus nicht aus Mörtelblasen bauen. Mit anderthalb einander störenden Händen, die mehrere Instrumentallehrer an den Rand des Wahnsinns trieben, schon dreimal nicht.
Aber Schluss mit nabelschauender Selbstkasteiung, dabei ja eher nur gewitzt gemeint ... zurück zum Thema.
Mein PDF im kürzlich gestarteten, und bald präventiv geschlossenen Thread wurde von euch beurteilt als, hier mal in meinen eigenen Worten
Wenn er auch in ernsthafter Absicht gestartet wurde: Man mag sich wundern, es war nicht auf dem Reißbrett entstanden. Sondern ist aus einigen falsch über halb, vielleicht auch mal auch ganz in Ordnung verstandenen Quellen kulminiert. Dieses Video gehört sicher zu den halbverstandenen.
Verstanden wurden offenbar auch mehr nur gefühlt als tatsächlich Ziegenrückers ABC, Allg. Musiklehre einfach erklärt, Hempels Harmonielehre, eine Jazz-Harmonielehre (Irgenein Sikora? möglich.), die beiden enzyklopädischen, diese natürlich nur selektiv verarbeiteten Bände Harmonielehre und Lexikon der musikalischen Form eines Reinhard Amon, zuletzt angefangen Rock&Jazz Harmony von Mathias Löffler ...
Alles mögliche, Literatur, die über Jahre gesammelt teilweise in meinem Bücherregal steht, teilweise aus der Stadtbücherei ausgeliehen wurde, und doch jetzt freundlicherweise vom Team dediziert mir empfohlen. Als Literatur empfohlen zu kriegen, was ich meinte gelesen zu haben ... bitter. Fazit: Nichts gelernt. Spätestens hier ist mir klar geworden, man kann ein Haus nicht aus Mörtelblasen bauen. Mit anderthalb einander störenden Händen, die mehrere Instrumentallehrer an den Rand des Wahnsinns trieben, schon dreimal nicht.
Aber Schluss mit nabelschauender Selbstkasteiung, dabei ja eher nur gewitzt gemeint ... zurück zum Thema.
Hört sich gut an, was er spielt und erklärt. Hätte er nichts gesagt, nur gespielt, könnte ich allenfalls sagen, dass das im Intro gerade langweilig ist im Vergleich zu dem danach. Irgendwie scheinen es aber überwiegend nur Patterns und Licks zu sein, über die er improvisiert, nur stellenweise erkennbare Melodiefragmente. Daran, dass ich sie nicht nachspielen oder in Noten schreiben könnte, seht ihr, dass diese Vermutung intuitiv ist, ein Schuss ins Blaue.
Bevor die Frage im Topic vergesse wird: Sind Modi mit Parallel- und Varianttonarten vereinbar? Haben diese Konzepte miteinander zu tun?
Beide Arten, wie Tonarten miteinander in Beziehung stehen,
- Varianttonarten C-Moll und C-Dur
- Paralleltonarten A-Moll und C-Dur,
sind diese Begrifflichkeiten auf die anderen fünf Modi erweiterbar? Ist D-Dorisch eine Paralleltonart von C-Ionisch bzw. C-Dorisch (Moll mit A und Bb) eine Varianttonart von C-Ionisch?
Im weiteren Verlauf des Videos wird ausgehend von
C - Dm - Am - G7
Stufen: I - IIm - VIm - V7 (- I ...)
Alle Stufen bilden eine Vollkadenz. IIm vertritt IV (Subdominantparallele), VIm die I (Tonikaparallele),nur der Dominantakkord tritt selber auf, sogar mit kleiner Sept. Diese Sept auf der V zieht sich durch alle Progressionen. Auch andere Stufen tragen eine, wenn sie den Modus eindeutig bestimmt.
Variationen abgeleitet, etwa C-Phrygisch, aber I bleibt ionisch, genauso wird alle vier Takte die ursprüngliche reine C-Dur-Progression wiederholt.
C Db Eb F G Ab Bb C
[I: Cm] [bII: Db] Eb Fm [V: Gm7b5] [bVI: Abmaj7]
C Db Ab Gm7b5 (Cm)
Die sogenannte Muttertonart beginnt immer ionisch, hier also Ab-Dur, und auch diese kann verwendet werden für alle Stufen außer der ersten:
Ab Bb C Db Eb F G Ab
[I: Ab] [II: Bbm] Cm Dbmaj7 [V: Eb7] [VI: Fm]
C Bbm Fm Eb7
Nachdem ich das Video gesehen habe und meine verstanden zu haben, hab ich, hat auch mein Hirn mal drüber geschlafen und, wie üblich und andere machens auch nicht anders, das gesammelte Wissen konsolidiert. Die Frage ist, ob ihm dabei kein Fehler unterlaufen ist, oder das alles nicht schon wieder ein einziger großer Fehler ist, dass sich ein Computernerd überhaupt mit der auf einer Metaebene ähnlich gestrickten Musiktheorie beschäftigt, so als Ausflucht vor der Erkenntnis, dass die Welt gerade den Bach runter geht und sein Beruf und sein einziges Können, natürlich nicht er selbst, sondern quasi seine Zunft, seine Kollegen, global betrachtet daran ziemlich große Schuld hat.
Konsolidierung / Verallgemeinerung / Offene Fragen:
- Stufe I bleibt unverändert Dur/Ionisch. Das könnte man – könnte man das in dem Zusammenhang? – den "primären Modus" nennen.
- Die anderen Stufen, hier II, VI, V (2/6/5), gehören zusammen einem weiteren Modus an, analog dem sekundären Modus.
- Nach einer gleichbleibenden Anzahl von Takten sei der sekundäre Modus mit dem primären identisch. So wird die Tonalität gestützt. Kann im nächsten Durchlauf der gleichen Anzahl Takte ein anderer Modus gewählt werden, wenn noch Melodie dazukommt?
- zwischen primärer und sekundärer Modus besteht für mein Verständnis eine Beziehung, die mich an den Begriff der Varianttonart erinnert.
- Zusätzlich stellt der Youtuber die Möglichkeit vor, primären und sekundären Modus (meine Worte/m. Verständnis: ) "auf der Achse der Paralleltonarten" zu verschieben: Was C-Phrygisch ist, hat denselben Tonvorrat wis As-Dur, so stammen die Stufen II, V und VI As-Dur, worin Phrygisch auf der dritten Stufe beginnt.
- Einem (autodidaktischen, aber als solcher beruflich beschäftigten) Programmierer drängt sich die Neigung auf, zwischen den Stufen Differenzintervalle zu bilden. II - I ist +1, VI - II ist +4, V - VI = -1. Was alle im Video vorgestellten Progressionen gemein haben ist, dass sie im sekundären Modus das Stufendifferenzprofil +1, +4, -1 gemein haben.
- Im Video wurde das Differenzprofil des sekundären Modus sowohl auf der Varianttonartenachse, als auch auf der Paralleltonartenachse gegenüber dem primären Modus verschoben.
So, ich verziehe mich mal wieder unter den Schreibtisch und warte, bis der Glaube verfliegt, ich hätte irgendwas verstanden. ;-) Das passiert nur durch Selbstdistanz, aber die wiederum nur durch Outing meiner kruden Denkprozesse.
An die Moderation: Diesmal kann ich wahrscheinlicher als letzte Woche am Sonntag antworten, tue ich aber nur, wenn es halbwegs gesittet zugeht. Wenn nicht, hat der Admin umsonst meinen Account unbenannt, da r/er auf der zweiten Zeile hing. Dann bin ich weg und wurschtel ganz allein vor mich hin. Wär schade aber auch mit weniger Stress verbunden.
Zuletzt bearbeitet:
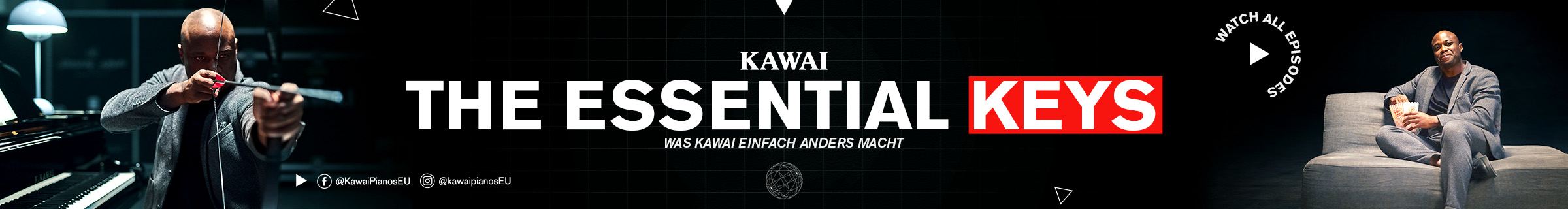
 ..
..