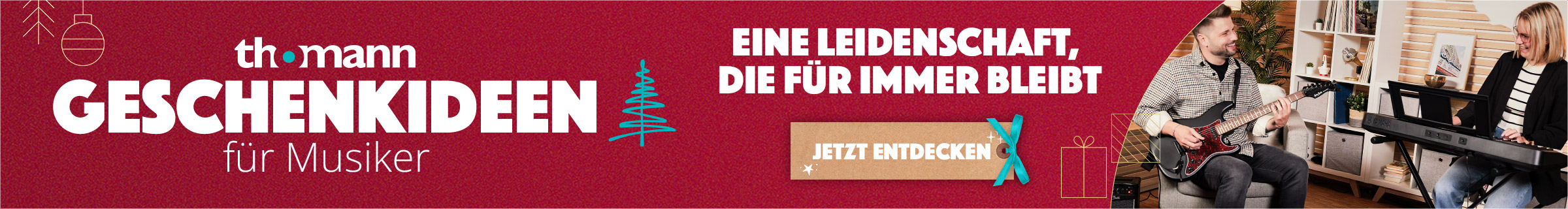Das kann nicht sein. Es würde bedeuten, dass Musiker sich "Ursprünglich und für recht lange Zeit" festen Regeln unterworfen hätten. Musik fand aber immer und überall statt, wo Instrumente gespielt und wo gesungen wurde. Da sangen also abends im Freien am Feuer oder später in der Ritterburg oder im Kloster alle einstimmig? Über lange Zeit? Kein Musiker kam mal auf die Idee, zur Grundmelodie eine zweite Stimme zu singen/zu spielen? Das widerspricht völlig meiner Vorstellung davon, wie sich Kirchentonarten entwickelt haben könnten.
Ich störe mich besonders am Wort "ursprünglich".
Ich will mich gerne bemühen, diese Verwirrung um den Begriff "ursprünglich" in diesem Kontext etwas aufzuklären.
Tatsächlich stammen die frühesten
schriftlichen, also überlieferten Aufzeichnungen in unserem Kulturkreis alle aus Klöstern. Nur dort gab es Personen, die des Lesens und Schreibens kundig waren, aber selbst unter den Mönchen war das noch lange eine Minderheit.
Und die derart überlieferte Musik war über sehr lange Zeit einstimmig.
Die Rede ist von den sog. "Gregorianischen Chorälen" - weiter oben hatte ich dazu schon zum Reinhören das "Graduale Project" verlinkt, wo die (nach wie vor gebräuchliche) Sammlung dieser Choräle gesungen wird mit mitlaufenden Noten (hier aber in der schon ´moderneren´ Quadratnotation, die ganz frühen Aufzeichnungen geschah in "Neumen") - hier nochmal der Link dazu:
Graduale Project
Die frühesten auffindbaren Aufzeichnungen mehrstimmiger Musik finden sich im 9. Jahrhundert in dem Text „Musica Enchiriadis“ (griech.: „Enchiridion“ = Handbuch).
Dort werden vor allem das Quint- und das Quartorganum beschrieben, hier dazu ein kurzes Hörbeispiel mit Noten:
Organum
Grundlage dieser Organum-Gesänge waren wiederum die einstimmigen Choräle, zu denen sich eine noch sehr simple zweite Stimme gesellte, die aber weitgehend zur Melodie in Quarten und Quinten parallel lief. Diese Zweistimmigkeit wurde wohl weitgehend improvisiert.
In diesem Text für die Schule findest du einige Erläuterungen dazu:
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/musik/artikel/organum
Spätere Beispiele gehen etwa auf das Jahr 1160 zurück, diese Epoche ab ca. 1160-1250 wird heute als "Schule von Notre Dame" bezeichnet. In dieser Quelle:
"Notre Dame" kannst du dazu etwas nachlesen, auch über die Unsicherheit der Quellenlage, weil nun mal sehr viele Auszeichnungen verschollen sind.
Die frühe Mehrstimmigkeit ist hauptsächlich kontrapunktisch, also mit einer mehr oder weniger großen Selbständigkeit der Einzelstimmen, eine Harmonik wie wir sie heute kennen existierte damals noch nicht.
Hier aus dieser Zeit ein Beispiel von Perotin (Mönch und Komponist aus der sog. Notre-Dame Schule), basierend auf der Melodie des "Viderut Omnes":
Viderunt
Tatsächlich ist besonders die frühe Kontrapunktik sehr Regel-basiert wie die erhaltenen alten Lehrwerke dazu zeigen.
Vielleicht kannst du jetzt besser nachvollziehen, was ich mit "ursprünglich" meinte. In dem Kontext, aus dem die Modi/Kirchentonleitern stammen, können wir erst mal nur die einstimmigen Gesänge der "Gregorianischen Choräle" nachweisen, und die frühesten Beispiele von Mehrstimmigkeit dürften auch kaum die Erwartungen erfüllen, die heute jemand spontan mit diesem Begriff verbindet.
Mit "ursprünglich" wollte ich auch ausdrücklich die Verwendung der Modi in moderner Zeit abgrenzen, wie sie etwa im Jazz auftauchen. Dort sind sie selbstverständlich auch harmonisch ausgedeutet und überhaupt Grundlage harmonischer Konzepte.
Das ist aber ein großer Unterschied zum - eben - historisch
ursprünglichen Kontext.
Wie die volkstümlich gespielte und gesungene Musik in der damaligen Zeit klang, darüber kann man mangels schriftlicher Aufzeichnungen nur spekulieren. Ob sie in der Mehrstimmigkeit weiter entwickelt war als die klösterliche Musik von der wir alleine Aufzeichnungen haben? Wer weiß. Die Rekonstruktion früher mittelalterlicher volkstümlicher Musik orientiert sich zum einen an den schriftlich vorhanden Quellen der "Kunst"-Musik (z.B. auch Minnegesang, Troubadours usw.) als auch den damals existierenden Instrumenten und ihren Möglichkeiten. So hatten z.B. die
Drehleiern immer die konstanten Bordun-Basstöne, üblicherweise eine Quinte, waren also weder mehrstimmig noch harmonisch flexibel.
Was den Ursprung des Musizierens im Allgemeinen angeht, so sind wir doch in der Natur von Klängen und Tönen allenthalben umgeben (sofern der Artenschwund nicht schon einiges davon zum Verstummen gebracht hat!). Ob es das Tirilieren der Vögel, das Muhen der Kühe oder die Wal"gesänge" sind, die Natur ist reichlich klangerfüllt.
Inwieweit jemand das als Musik im weitesten Sinne ansehen mag, muss jeder selber entscheiden.
Vieltönig ist es sicher, mehrstimmig im msikalischen Sinne wohl eher nicht.
In diesen Klangreigen werden auch die frühen Hominieden mit eingestimmt haben, sie hatten ja einen Kehlkopf und Stimmbänder, wenn auch der Stimmapparat noch nicht zum Sprechen geeignet war. Das kam erst viel später.
Insofern hat der Mensch wahrscheinlich eher gesungen (jedenfalls so ähnlich) bevor er Sprechen konnte.