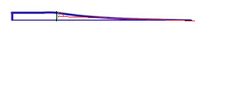Klangbutter
HCA Akkordeon-Spieltechnik
- Zuletzt hier
- 04.02.26
- Registriert
- 03.10.10
- Beiträge
- 5.527
- Kekse
- 76.628
- Ort
- Sachsen Anhalt
Ist die Annahme einer unvorteilhaften Neutralfasergeometrie beim unidirektionalen Schliff aus werkstoffmechanischer Sicht wirklich nachteilig? Die Diskontinuität in der Differenzierbarkeit der Neutralfaserkurve bildet in der Praxis in der Regel keinen relevanten Schwachpunkt, solange die durch die Profilgeometrie induzierten Spannungsgradienten innerhalb des elastischen Bereichs verbleiben.
Die idealisierte „absolute Linearität“ der Neutralfaser beim bidirektionalen Schliff ist aus mathematischer Sicht ein Grenzfall stetiger Differenzierbarkeit, das stimmt wirklich. Jedoch ist die reale Schwingungsantwort einer Stimmzunge auch durch die fluiddynamisch-akustische Kopplung in der Stimmplatte bestimmt. Die mechanische Eigenform der Zunge (also die „intrinsische“ Schwingung) und die akustische Rückkopplung über die Umgebung stehen in einem stark nichtlinearen Verhältnis, sodass sich der postulierte Vorteil einer idealisierten Geometrie nur sehr bedingt auf das klangliche Resultat übertragen lässt.
Eine theoretisch „optimale Verschlusssynchronizität“ ließe sich durch eine abgestufte, profiliert abgesetzte Stimmplattengeometrie konstruieren, aber irgendwie widerspricht dies dem bekannten Prinzip der robusten Serienfertigung. Es wäre also sinnvoll, das Problem weniger auf der Ebene geometrischer Idealität zu diskutieren, sondern eher im Rahmen einer energetischen Bilanzierung: wie groß ist der tatsächliche Beitrag der neutralfaserbasierten Geometrie zur Gesamtimpedanz der Schwingungskette Zunge–Platte–Luftsäule? Ich denke, anders kommen wir nicht zu einer belastbaren Beurteilung des postulierten Vorteis.
Ein Wort noch zu den Blechhalbzeugen:
Die Literatur (vgl. Niemand et al., Journal of Hypothetical Reed Dynamics, 2023) zeigt, dass die akustische Relevanz der Neutralfaserkontinuität spätestens dann marginal wird, wenn die Zunge im Schraubstock mitschwingt.
Die „ideale Verschlusssynchronizität“ existiert nur theoretisch – in der Praxis dominiert eher die Chaoskomponente. Oder wie man auch sagen könnte: Die Zunge macht sowieso, was sie will.
Die idealisierte „absolute Linearität“ der Neutralfaser beim bidirektionalen Schliff ist aus mathematischer Sicht ein Grenzfall stetiger Differenzierbarkeit, das stimmt wirklich. Jedoch ist die reale Schwingungsantwort einer Stimmzunge auch durch die fluiddynamisch-akustische Kopplung in der Stimmplatte bestimmt. Die mechanische Eigenform der Zunge (also die „intrinsische“ Schwingung) und die akustische Rückkopplung über die Umgebung stehen in einem stark nichtlinearen Verhältnis, sodass sich der postulierte Vorteil einer idealisierten Geometrie nur sehr bedingt auf das klangliche Resultat übertragen lässt.
Eine theoretisch „optimale Verschlusssynchronizität“ ließe sich durch eine abgestufte, profiliert abgesetzte Stimmplattengeometrie konstruieren, aber irgendwie widerspricht dies dem bekannten Prinzip der robusten Serienfertigung. Es wäre also sinnvoll, das Problem weniger auf der Ebene geometrischer Idealität zu diskutieren, sondern eher im Rahmen einer energetischen Bilanzierung: wie groß ist der tatsächliche Beitrag der neutralfaserbasierten Geometrie zur Gesamtimpedanz der Schwingungskette Zunge–Platte–Luftsäule? Ich denke, anders kommen wir nicht zu einer belastbaren Beurteilung des postulierten Vorteis.
Ein Wort noch zu den Blechhalbzeugen:
Die Literatur (vgl. Niemand et al., Journal of Hypothetical Reed Dynamics, 2023) zeigt, dass die akustische Relevanz der Neutralfaserkontinuität spätestens dann marginal wird, wenn die Zunge im Schraubstock mitschwingt.
Die „ideale Verschlusssynchronizität“ existiert nur theoretisch – in der Praxis dominiert eher die Chaoskomponente. Oder wie man auch sagen könnte: Die Zunge macht sowieso, was sie will.


 ). Ansonsten ist es mir völlig egal. Ich spiele meine Musik, die ich liebe
). Ansonsten ist es mir völlig egal. Ich spiele meine Musik, die ich liebe  , und ich möchte sie spielen, solange Gott es mir erlaubt …
, und ich möchte sie spielen, solange Gott es mir erlaubt …