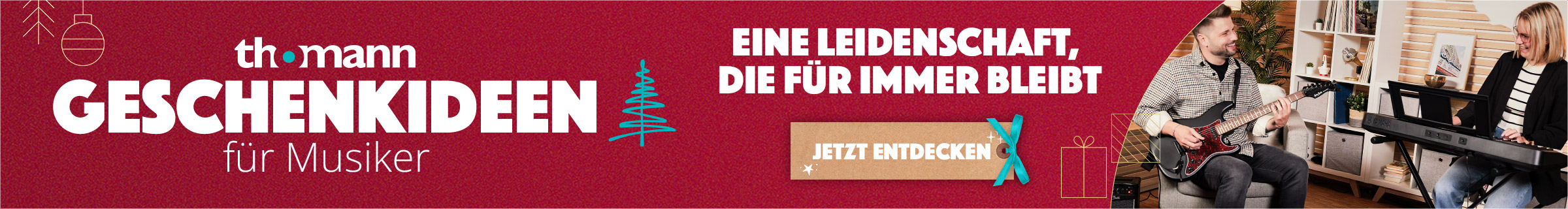@LWinkler, erst mal Danke für deine anregenden, wenn auch kontroversen Beiträge. Wenn jemand mal Gedanken beisteuert, die das eine oder andere sozusagen "auf links drehen" regt das ja erst mal an, seine eigenen Gedanken dazu kreisen zu lassen, und vielleicht das eine oder andere (mal wieder) zu hinterfragen.
Eine Frage habe ich: Hast du Unterrichtserfahrung mit Musik-/Instrumental-Anfängern? Ich vermute, nein.
Denn da muss ich
@McCoy recht geben, der weiter oben geschrieben hat, dass man gerade bei Anfängern mit Theorie sehr zurückhaltend sein muss.
Wer noch gar nicht Noten lesen kann, hat schon Mühe genug damit, von den Komplikationen, seine Finger und Hände am Instrument zu sortieren und zu koordinieren gar nicht erst zu reden.
Da sind Infos oder gar Vorträge über Tonleitern und sonstige Skalen, über Modi und Diatonik nutzlos, schlimmstenfalls kontraproduktiv, weil es nicht nur Unterrichtszeit verschwendet, sondern auch frustrieren und demotivieren kann.
Da heißt es für den Lehrenden, Geduld zu haben und zu warten, bis sich das Auffassungsfenster beim Schüler für Theorie öffnet. Bei dem einen ist das früher der Fall als dem anderen, einige Türen gehen weit auf (eher wenige), die meisten gehen nur einen Spalt auf, bei manchen öffnen sich die "Theorie-Türen" gar nicht.
Ist im Einzelfall auch o.k., erzwingen lässt sich bekanntlich nichts.
Und wenn das Thema schließlich dran kommen kann, dann ist es angeraten, bei der Hör- und Spielerfahrung der Schüler möglichst elementar anzuknüpfen.
Wenn die Kids (aber auch Erwachsene) einige Kenntnis von einfachen, bzw. Kinderliedern haben (wie sie ja je nach Konzept im Schulmaterial vorkommen, Kinderlieder nicht unbedingt immer, immer aber einfache Melodien), dann werden es rein statistisch betrachtet, vornehmlich Stücke in Dur sein. Und weil alterierte Töne im Unterrichtsmaterial auch immer etwas auf sich warten lassen, wird das frühe Material typischerweise in C-Dur notiert sein.
Dann aber zuerst mit A-H(B)-C-D-E-F-G-A, also A-Moll zu kommen, weil - mindestens bei Verwendung der internationalen "B" statt "H" (was so in deutschsprachigem Unterrichtsmaterial gar nicht vorkommt, also auch erst mal erklärt werden muss) - das der Reihenfolge des Alphabets entspricht, scheint zwar auf den ersten Blick logisch zu sein.
Aber die (deutschsprachigen) Tonnamen
benutzen zwar die Buchstaben des Alphabets, aber sie
meinen etwas anderes, nämlich
Töne. Das leuchtet implizit auch allen Anfängern ein, ist reiner Lernstoff und verwirrt keinen meiner Erfahrung nach.
Dann noch sofort die Kirchentonleitern/Modi drauf zu setzen, das ist denn doch für Anfänger zu "starker Tobak".
Das halte ich für verwirrend.
Ergänzen möchte ich noch, dass es nur sehr wenige einfache Melodien gibt, die alle 7 Töne ihrer zugrunde liegenden Tonart/diatonischen Skala nutzen (typischerweise fehlt ganz oft die 7. Stufe in der Melodie), nicht wenige haben noch weniger als selbst 6 Töne.
Aus diesen Melodien die Tonleiter abzuleiten, wird so ohne weiteres also gar nicht gelingen. Als Fazit sehe ich Skalen als eher abstraktes Tonmaterial, als mehr abstrakte "Töne-Sammlung" an. Für Anfänger in der Regel als Konzept zu abstrakt.
Auf die musiktheoretischen Konzepte der (griechischen) Antike einzugehen um die historische Entwicklung in den Blick zu nehmen [Anmerkung: auf diesem Gebiet habe ich nur eher flüchtige Kenntnisse] halte ich jedoch in diesem Fall für wenig zielführend, so interessant und spannend das aus musikwissenschaftlicher Sicht sein mag, und so sehr ich im Allgemeinen historische Betrachtungswinkel für wichtig halte.
Es stellt sich nämlich die Frage, ob und inwieweit es eine
Kontinuität in der Musik von der Antike bis zum Mittelalter überhaupt gegeben haben mag. Historisch gab es die ersten sozusagen "offiziellen" Rückgriffe auf die Antike in der Epoche, die wir heute die "Renaissance" nennen (daher ja auch der Name: "Wiedergeburt der Antike"). Aber diese Epoche folgt historisch
nach dem Mittelalter (und löst dieses in unserer heutigen Betrachtung ab - in Wirklichkeit verläuft die Geschichte natürlich in fließenden Übergängen, aber die Einteilungen sind ja nicht unbegründet und sind auch hilfreich).
Inwieweit die Musiktheoretiker - und Praktiker - des frühen bzw. überhaupt der Mittelalters in der Tiefe über die Musiktheorie und Musikausübung der Antike Bescheid wussten? Vermutlich hatten sie keine tieferen Einblicke, eine auf Wissenschaft basierte Forschung gab es seinerzeit noch nicht, sie benutzen aber wohl die alten Begriffe "Dorisch, Phrygisch, usw."
Dabei gibt es einen bemerkenswerten Aspekt zu berücksichtigen der hier noch gar nicht zur Sprache kam: Im antiken Griechenland wurden die Skalen
abwärts gedacht. Die Modi, und überhaupt alle Skalen, die seit dem Mittelalter und bis heute in unserem Kulturkreis verwendet werden, denken wir aber als
aufwärts gehende Linie.
Ich sehe das als einen
fundamentalen Unterschied an, wenn es darum geht, die klangliche Ausprägung von Skalen zu beurteilen.
In jedem Fall ist zu konstatieren, dass sich diese Denkweise nicht von der Antike bis ins (Früh-)Mittelalter gerettet hat. Und seitdem halten wir es wie gesagt so, dass wir eine Skala erst mal grundsätzlich als
aufsteigende Leiter ansehen.
Besonders wichtig wird das im Zusammenhang mit dem Konzept der
Leittöne, die letztlich ausschlaggebend waren, dass sich aus der modalen Musik gegen Ende des 16. Jahrhunderts die "Dur-/Moll-Tonalität" entwickelt hat. Aus den "Klauseln" wurden irgendwann die "Kadenzen", und nicht zuletzt ist das Prinzip von "harmonisch Moll" dem zwingend für die Bildung einer ´echten´ Dominante notwendigen Leitton auf der 7. Stufe geschuldet.
Der historische "Siegeszug" der Dur-Moll-Tonalität, die auch heute noch weite Teile der Musikwelt dominiert, ist nicht zu übersehen, deshalb gehe ich nicht weiter darauf ein.
Dabei ist die Musikwelt heutzutage bemerkenswert komplex, ohne Frage. Und spätestens gegen Ende des 19. Jahrhunderts weitet sich die Dur-Moll-Tonalität immer weiter auf, wird schließlich immer chromatisch komplexer, und irgendwann ganz überwunden (Stichworte "Zwölftonmusik", serielle Konzepte, u.a.m.).
Über modale Konzepte im Jazz wurde hier schon geschrieben, weitere komplexe Skalen wurden auch schon erwähnt.
Alles in allem sehr spannend, aber für den ersten Einstieg würde ich immer beim ´schlichten´ Dur, am besten C-Dur (wegen der
Stammtöne) bleiben. Und dann Schritt für Schritt aufbauen, je nach Neigung und Interesse.
Einen interessanten Aspekt zum "Abwärts-Denken" der antiken Modi will ich hier noch erwähnen:
Tatsächlich sind alle Modi von ihrer spezifischen Intervallstruktur her auch abwärts darstellbar, sie lassen sich sozusagen spiegeln. Man muss dabei aber beim E anfangen (wenn ich von Ionisch ausgehe).
Dann finden sich die Modi alle in gleicher Folge, aber
abwärts (in Klammern die Positionen der Halbtonschritte):
E - Ionisch (34 78)
D - Dorisch (23 67)
C - Phrygisch (12 56)
H - Lydisch (45 78)
A - Mixolydisch (34 67)
G - Äolisch (23 56)
F - Lokrisch (12 45)
Lokrisch war im Übrigen für die mittelalterliche Kirchenmusik deshalb unbrauchbar, weil sie vom Grundton aus keine reine Quinte hat - für die mittelalterliche Musik wenn man so will
das zentrale Intervall (z.B. als "Repercussa", als Rezitationston).
@LWinkler, wenn es dich interessiert, findest du hier eine schöne Sammlung der alten Kirchengesänge:
"Graduale"
Bach hat auch beide Schreibweisen genutzt, je nachdem für wen oder welche Region sein Werk komponiert war. Er hat die Schreibweise h sogar genutzt um sein Namen zu verewigen und hat in einigen Kompositionen das "Bach-Motiv" eingebaut.
Meiner Kenntnis nach hat Bach das "B" und "H" stets so verwendet wie wir das im deutschsprachigen Raum heute auch machen, "B" also für Bb/B-flat.
Sein Namensmotiv B-A-C-H wäre mit den englischen B und Bb/B-flat auch gar nicht möglich gewesen.
Stieß in der damaligen Gesellschaft wohl auch nicht so auf Gegenliebe sich so hervorzutun.
Hast du Quellen dazu? Bach wurde zwar immer wieder kritisiert wegen der Komplexität seiner Musik, die viele Zuhörer damals etwas überforderte. Die Kritik kam z.B. von Presbytern, die entsprechende Beschwerden von Gemeindemitgliedern zu hören bekamen.
Dass aber die Verwendung seines musikalischen Namensmotivs kritisiert wurde, davon habe ich noch nie gehört. So oft hat er es ja auch nicht verwendet (z.B. in der Schlussfuge der "Kunst der Fuge" - die aber seinerzeit nicht zur Aufführung kam, war ja auch nicht instrumentiert, sondern nur eine Stimmenpartitur.