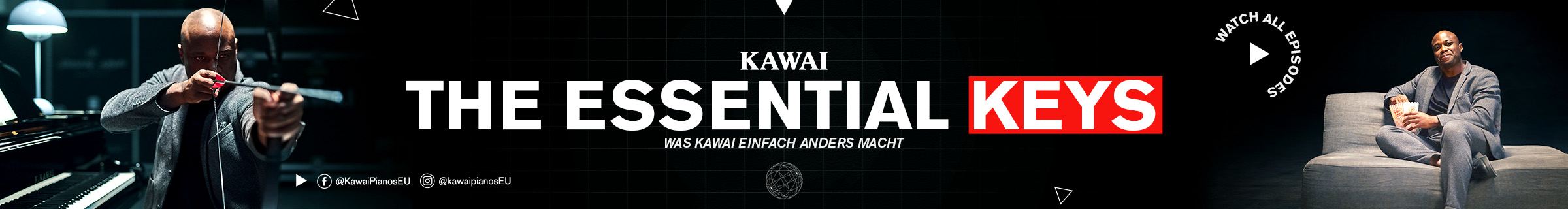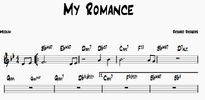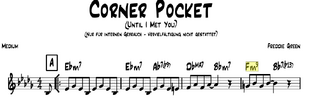Schon für die einfachst-möglichen Beispiele sehe ich kein "erstmal", nur ein "entweder - oder".
Mit "Bread and Butter" meine ich, wenn ich jemandem erstmal erkläre, wie man über einen Titel improvisiert.
Dann möchte ich nicht mit mehreren Varianten anfangen, sondern erst einmal eine Variante anbieten, die in 80% der Fälle funktioniert.
Dass man immer Sachen findet, wo das dann nicht passt, ist klar.
Schon für die einfachst-möglichen Beispiele sehe ich kein "erstmal", nur ein "entweder - oder".
Fmaj7: ionsch in F-Dur, lydisch in C-Dur
Du weißt das natürlich alles, aber trotzdem: Hier gehen ja normalerweise beide Varianten, wenn nicht grade ein 4-3 Vorhalt oder die #11 in der Melodie ist. Der Unterschied ist nur die Quarte, und die wird in den meisten Stücken sowieso nicht auf schweren Tönen verwendet.
In der Impro kann man ohne Vorbereitung ionisch spielen und die Quarte "avoiden" und macht erstmal nichts falsch. Oder wenn es etwas moderner klingen soll und Platz ist, die #11 spielen.
Bei Swing oder American Songbook-Titeln würde ich immer für einen Dur-Akkord erstmal ionisch ohne 11 nehmen. Im Akkord kann man 9, 13 und die maj7 verwenden, passt.
Dm7: ... phrygisch in Bb-Dur
Aus meiner bescheidenen Praxis gesprochen: Phrygisch habe ich über Dm noch nie gespielt. Eb ist die Quarte in Bb-Dur, die spiele ich dann ohnehin standardmäßig nicht. Spielt man Dorisch über D, ist das E nicht dissonant und in Bb dann die #11, die auch gut klingt.
Ohne weitere Infos würde ich persönlich auch in einer Bb-Progression einfach keinen Ton Eb spielen, wenn Dm da steht. Dann muss man sich auch nicht darüber Gedanken machen.
Ich habe vorhin, weil wir grade bei den Büchern waren, ein bisschen im Mark Levine Jazz Piano gelesen. In seinem Kapitel über Scales schreibt er in der Einleitung:
"...the best jazz musicians think of them as an 'available pool of notes' to play on a given chord, rather than as 'do-re-mi...' and so on [...]
The scale and the chord are for the most part two forms of the same thing."
Die Skala ist also in dem Sinne keine Tonleiter, sondern der Tonvorrat, der über den Akkord gut klingt. Ein Tonvorrat, der passt (so würde ich
available pool mal ganz praktisch übersetzen) muss ja nicht zwangsweise eine komplette Tonleiter ergeben. Klar ist das in der Theorie schön. Aber was nützt mir ein Ton in einer theoretischen Scale, den ich eh nicht verwenden kann.
Für mich heißt das, wenn für das Stück die 11 dissonant klingt und die #11 zu modern, dann spiele ich halt auf schwere Taktzeiten keine 11, weil sie nicht zu meinem "available pool of notes" gehört.
Ob das dann eine Ionisch ohne 11 oder eine Lydische ohne #11 ist ... wäre mir in dem Fall egal.

Als Durchgangsnote/Approach tone usw. geht dann wahrscheinlich auch beides, die 11 mehr in Richtung 3 und die #11 in Richtung 5.
Genauso mit Moll und der b6. Die klingt für mich meistens im Akkord nicht gut und gehört deshalb vielleicht theoretisch zur Scale, wenn du bei der IIm schon an die I denkst, aber praktisch ist sie nicht verwendbar.
Dh
wenn ich es einem Einsteiger erkläre oder selbst keinen weiteren Kontext habe, spiele ich
über D-Moll immer Dorisch, und über Dur Dur (avoid 11).
Und wenn die große 6 (13) bei Dorisch nicht gut klingt, dann merke ich das und spiele beim nächsten Mal keine 6 oder die kleine.
So ist jedenfalls mein praktischer Ansatz, mit dem ich aktuell gut klar komme - ich lerne aber wie Du weißt immer gern dazu; also wenn irgendwas davon falsch oder unpassend sein sollte, bin ich offen.
Ich arrangiere aber idR auch nicht, sondern improvisiere. Bei einem durchkomponierten Arrangement hat man natürlich mehr Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und natürlich wird es musikalisch auch interessanter, wenn man mehr Auswahl hat.
---
EDIT
Schaue mir gerade das Video an.
Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen an einer anderen Herangehensweise, dass ich da pragmatischer bin?
In der ersten Zeile von Have you met Miss Jones
erklärt er, dass F#° "the seven diminished of the target" VII°/II ist. Bei mir ist das einfach ein D7b9 ohne Grundton als Zwischendominante zu G. Als Stufe wäre die Zeile eine I - VI - II - V,
Der Tonvorrat dürfte damit aber der Gleiche sein - für mich F-Dur (avoid 11) / D HTGT / G Dorisch / C mixo (ggf. mit Alterationen nach Kontext).
In der Bridge (5:00 min ff.) erklärt er, dass das III - VI- II in einer III - VI - II - V - I keine Modulation nach VI sein sollte, sondern diatonisch, weil das für die Hörer nicht so anstrengend ist.
Ich kann das nachvollziehen, aber im konkreten Beispiel
ist das (nach meinem Eindruck) durch die Zwischendominante D7b9, die ja gerade nicht diatonisch ist, nicht eindeutig. Ich kann ja über D7b9 nicht die F-Dur-Scale spielen.
Diatonisch wäre Am7 - Dm7 - Gm7 - C7. In dem Moment, wo ich eine "echte" IIm-V7 spiele, schaffe ich, wenn auch kurz, ein neues tonales Zentrum, was natürlich auch von der Form her noch keinen Ruhepunkt darstellt und sich wieder zur Tonika weiterbewegt.
Also ich kann seinen pädagogischen Ansatz nachvollziehen, aber für mich sind da beide Denkweisen schlüssig und führen letztlich auch nicht zu total unterschiedlichen Resultaten.
Pragmatisch spiele ich da Am dorisch / D HTGT / G dorisch / C mixo (oder alt. oder HTGT) - F (avoid 11).
Wenn bei Am7 ein Ton Bb in der Melodie ist, müsste man natürlich das spielen und nicht B (H), das merkt man dann ja aber.
Ich hoffe, mein Ansatz ist soweit plausibel - wenn nicht, wie gesagt immer her mit Kritik

BTW - Nutzt Du seine "Map" für die Akkordzusammenhänge?
Für mich sieht das auf den ersten Blick übermäßig kompliziert aus, aber es ist interessant, dass ich mir über eine grafische Repräsentation der Funktionszusammenhänge noch nie Gedanken gemacht habe. Das passiert bei mir glaube ich mit einer inneren Repräsentation der Tastatur und des Quintenzirkels.